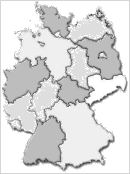|
|
Fest der Freiheit2000-2006Im Zuge der Entwicklung der Arbeit in Duisburg wurde dann relativ schnell klar, daß sich an einem Datum nicht alles vermitteln ließ, und daher wurde schon in einem ersten Arbeitskonzept am 27. Januar 2000 festgehalten: Neben das "negative" Gedenken sollte ein "positives" treten. Insbesondere wäre der Verfassungstag, der 23. 5., nicht nur als Kontrapunkt, wie in dieser Unterlage geschehen, aufzuführen, sondern selbst inhaltlich auszugestalten. Es gibt nicht nur belastendes Erbe aus der Zeit der "Großeltern", sondern auch zu bewahrendes aus der Zeit der Eltern. "Erinnern und Begreifen", dieser Prozeß umschließt beide Elemente. In diesem Zusammenhang wäre dann der heranwachsenden Jugend das andere positive Element, die Europäische Versöhnung, der Aufbau der Europäischen Union in ihrem Stellenwert zu verdeutlichen. (Quelle: 27. Januar in Duisburg - Handlungsvorschläge für die Jahre 2000 - 2005, S.2)
So unstrittig diese Aussagen sein mögen, es sind Aussagen, die in ihrer Selbstverständlichkeit von Westdeutschen getroffen werden. Für Ostdeutsche beginnt die Geschichte, zwar nicht der Bundesrepublik, aber ihrer Bundesrepublik mit dem Beitritt der neuen Länder zum Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland. Und bei allen Ansprüchen an die Segnungen, die diese Konstruktion auch beinhaltete, bedeutete sie für den ehemaligen DDR-Bürger den Austritt aus der eigenen Staatsgeschichte, nämlich der der DDR, und der Eintritt in eine fremde Staatsgeschichte. Dies wurde in der Geschichte der neuen Republik nie wirklich verarbeitet - er trieb bis in die neueste Vergangenheit richtiggehende Stilblüten. Als ein Beispiel sei nur erwähnt: Vor nicht allzu langer Zeit schlugen ostdeutsche Politiker vor, einen jährlichen "Tag des Parlamentarismus" am 18. März einzuführen. Ihr Bezugspunkt war, man glaubt es kaum, nicht der 18. März 1848, das historische Freiheitsdatum Deutschlands als Ganzem, sondern das Datum in einem Übergangsakt in einem untergehenden deutschen Kleinstaat, der 18. März 1990. Wie in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine "re-education" erforderlich gewesen war, wäre dies auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR erforderlich gewesen. Denn woher sollten nach fast 60 Jahren ununterbrochener Diktatur auf einmal die Massen gefestigter Demokraten hergenommen werden, um in der Übergangskrise den neuen Staat aufzubauen und trotz aller Schwierigkeiten, Anerkennung für ihn in der neuen Bevölkerung zu schaffen und zu organisieren. Ein solches Bildungsprojekt konnte aber schlecht angegangen werden, schließlich galt als gültige Wahrheit: Die DDR-Bevölkerung habe in der "friedlichen Revolution" ihre "Freiheit" erkämpft. Erfolgreiche revolutionäre Demokraten bedurften selbstverständlich keiner staatlichen Anleitung mehr. Nur bei Lichte betrachtet, handelte es sich bei der "friedlichen Revolution" im wesentlichen nicht um eine Leistung einer insurgenten Bevölkerung, sondern um die von der Schutzmacht UdSSR genehmigte und wohlwollende begleitete Liquidation eines ihrer Vasallenstaaten durch Teile von dessen eigener Bevölkerung. Es handelte sich also, um Lenins Spott über die Deutschen, die Revolution und die Bahnsteigkarten, um eben eine solche deutsche Revolution. Mehr Schall als Rauch, mehr Mythos als Realität. Dies ist keine Kritik am Verlauf, dieser war zweckmäßig. Dies ist keine Leugnung des Mutes und der Zivilcourage der Bürgerrechtler in den letzten Jahren der DDR - nur waren diese eine hauchdünne Minderheit und wurden nicht mentalitätsbildend in die Breite der Bevölkerung. Deren Programm blieb bis zuletzt individualistisch-hedonistisch: Kein Theater, sondern "Rübermachen". So diente denn in den Jahren nach 1990 auch der neudeutsche Mythos von der inneren Bewältigung der eigenen deutschen Probleme, der Mythos von der "friedlichen Revolution", dazu die Anerkennungsprobleme des je nach Ausgangspunkt alten oder neuen Staates erst zu leugnen und dann auch noch auf beiden Seiten des früheren "Eisernen Vorhanges" wegen dieser Leugnung schrittweise zu verstärken. Denn in den gesellschaftlichen Verteilungskämpfen der ersten Hälfte des neuen Jahrzehnts wurden die Versorgungssicherheit für die gesellschaftlichen "Ränder" und die Kosten dieser Versorgungssicherheit für die anderen Gesellschaftsmitglieder zum alles beherrschenden Thema. Die Freiheit des Konsums und die Freiheit zum Konsum standen überall im Mittelpunkt - wie in den Wirtschaftswunderjahren der alten Republik. Nur wurde nicht, wenn auch unterschiedlich, allen gegeben, sondern den einen genommen, um den anderen zu geben - oder, je nach Standpunkt, den einen wurde genommen, damit anderen etwas mehr verblieb. Und damit wurde im Rahmen der neuen Bundesrepublik die Mentalität der alten DDR ins Recht gesetzt: Der Staat ist meines Glückes Schmied. "Fest der Freiheit" - im Rückblick gesehen, stand diese Idee gegen den Zeitgeist. Den einen war der Staat ein Räuber, weil er ihnen trotz aller Reformen noch immer so immens hohe Steuern abnahm, den anderen war ein Räuber, weil er ihnen die Sozialleistungen zusammenstrich. Diesen Staat zu feiern, war beiden Seiten mehr als fremd. Dies war auch bei der Umsetzung zu merken. Nicht anhand offener Ablehnung, die war selten. Sondern indirekt, an der jahrelangen Tingelei, die erforderlich wurde, um das "Fest der Freiheit", so wie wir es wollten, auch organisieren zu können. Wie bei Popbands waren, bevor diese erst einmal in der Arena stehen, die Kneipen- und Clubauftritte gefordert. Dabei waren die Ausgangserwartungen unsererseits eigentlich simpel euphorisch: Die Idee ist plausibel, letztlich schadet ein solches Fest keiner bedeutenden politischen Kraft, die werden schon bei einer so zündenden Geschichte zugreifen. Es griff aber niemand zu, und als uns dann im Jahr 2005 Hilfe von privater Seite angeboten wurde, begannen wir das Vorhaben selbst in die Hand zu nehmen. Dabei wurde uns dann aber sehr schnell klar, warum niemand zugegriffen hatte. Letztlich gab es keine Institution von Bedeutung, die es glaubwürdig gekonnt hätte, der das von uns verfolgte Ziel, auf ehrenamtlicher Basis tätig zu werden, zu diesem Zeitpunkt halbwegs abgenommen worden wäre. Überall wurden das Kostendeckungsprinzip eingeführt, überall war jede Kleinigkeit dem Controller gegenüber zu rechtfertigen, überall wurde die neue Pflicht zur Nebeneinnahme entdeckt ... Die allgemeine Sehnsucht nach Einnahmemaximierung und Kostenminimierung war jedoch schizophren organisiert: Zugleich galten die neuen Regeln des Casinos. Nur viel Geld kann viel bewirken - auf Kleinprojekte, mit denen ihnen eigenen Segnungen ließ sich kaum noch Aufmerksamkeit lenken. Allen diesen denkbaren Trägern wäre entgegengehalten worden: Das ist der neueste Schmuddeltrick im Arsenal der staatlichen oder sonstigen Sparmaschinerie, jetzt sollen den Künstlern auch noch die Gagen zusammengestrichen werden. Dabei hat es doch im Grunde keinen gemeinnützigen, meint: mildtätigen Zweck. Es bedurfte der Niemande, die selber wirtschaftlich nichts an diesem Vorhaben zu gewinnen hatten, um die Bedeutung der staatspolitischen Überlegungen, die Bedeutung des Einsatzes des Demokraten für seine Republik nicht bloß zu deduzieren, sondern zu beweisen. Hier sollen nicht die einzelnen Zwischenschritte, die zum Teil quälenden organisatorischen und finanziellen Probleme dargestellt werden - den wiedergegebenen Dokumenten können diese zum Teil entnommen werden, aber veröffentlicht wurden diese aus einem anderen Grund. Ihnen können die wesentlichen konzeptionellen Entwicklungsschritte entnommen werden. Denn letztlich hat keine dieser Runden geschadet, in jeder dieser Schleifen konnte für die Idee geworben, weitere Unterstützung gewonnen werden. |